Frauen am Altar? Auch Kleriker stossen an Grenzen
Die Gestaltung des Gottesdienstes beim Abschied von Seelsorgerin Monika Schmid in Effretikon löste eine lebhafte Debatte zur Rolle der Frau in der katholischen Kirche aus. In der Folge erzählten zwei gestandene Seelsorgerinnen von ihren Erfahrungen, die sie als Frau in der Kirche machen, wo sie in ihrem seelsorgerlichen Wirken an Grenzen oder auf Vorurteile stossen und was das bei ihnen auslöst. In einem Aufruf haben wir Seelsorgerinnen und Seelsorger aufgerufen, ihre Erfahrung mit uns zu teilen. Beiträge bekommen haben wir von Zita Haselbach, einer pensionierten Seelsorgerin, aber auch von zwei geweihten Männern: Dem ständigen Diakon Markus Schenkel und dem Priester Alexander Bayer. Drei sehr persönliche, sachliche und nachdenklich stimmende Beiträge aus der Seelsorge an der kirchlichen Basis.
Sei du die Veränderung, die du dir wünschst
«Ich habe meinen Beruf geliebt und blicke mit Dankbarkeit auf 20 Jahre als Gemeindeleiterin zurück. Ich hatte das Glück, mit Pfarradministratoren und fast immer mit Priestern zusammenzuarbeiten, die mir seelsorgerlich und liturgisch sehr viel Freiraum liessen. Dabei beobachtete ich, dass die Gemeinde ein sehr gutes Gespür hat, wo wir ein echtes geschwisterliches Zusammenspiel auch in der Liturgie leben konnten und wo nicht. Und die Gemeinde gab mir sehr deutlich zu verstehen, dass sie hinter mir steht.
In den ersten zwei Jahren, als ich in Winterthur und Umgebung die erste Gemeindeleitende war, litt ich manchmal an der Situation der Frau in der Kirche. Einmal wollte ich aufgeben, aber dann bekam ich ein sehr klares Zeichen und machte entschieden weiter.
Für mich kann das Ziel nur sein, dass die Frauen zu allen Ämtern zugelassen werden – und dass die Care-Arbeit in der Kirche, also die Diakonie, der Liturgie, der Verkündigung und der Gemeinschaftspflege gleichgestellt wird.
Mich begleiteten einige Leitgedanken:
- In der konkreten Zusammenarbeit trenne strikt strukturelle von persönlichen Problemfeldern.
- Liturgie ist nicht der Ort Kirchenpolitik zu machen, wohl aber Ort für die Würde aller einzutreten.
- Wenn ich Grenzen überschritt, dann entweder, weil es nicht die zentralen Fragen des Glaubens betraf oder weil es die Mitmenschlichkeit erforderte (ich sang einmal die Präfation weiter, als dem Priester die Stimme versagte).
- auch in der Seelsorge im Alterszentrum fanden die Senioren und ich oft gute Wege, aber es machte mir auch nichts aus, einen Priester zu rufen und gemeinsam die Krankensalbung zu feiern, wenn für eine Person die Anwesenheit des Priesters sehr wichtig war.
- Im Zweifelsfall sagte ich mir, die entscheidende Frage wird einmal sein: Hast du dem Nächsten….
Es ist vielleicht ein abgegriffenes Wort, aber ich liebe «die Kirche» und versuche deshalb, in meinen Worten nicht zu verletzen. Die Kirche hat mir in meinem Leben so zentrale Botschaften vermittelt und mich so viele gute Erfahrungen machen lassen. Sie hat mir so viele Weggefährtinnen, Weggefährten und Gleichgesinnte geschenkt, die sich für caritative Anliegen einsetzen. Das schliesst nicht aus, dass ich an der Langsamkeit der Kirche, ihren schrecklichen Fehlern, ihrer Unbeweglichkeit leide und oft wütend bin. Und manchmal leide ich auch an der mangelnden Solidarität unter Seelsorgenden. Dann sage ich mir laut und deutlich: «Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.» (Gandhi) und «Sie können ein paar Blumen zertreten, aber den Frühling nicht aufhalten.»»
Hoffnung auf einen geschwisterlichen Weg in der Kirche
«Dürfen Sie das als verheirateter Mann? Diese Frage wurde mir noch nie gestellt. Auch wenn ich ständiger Diakon bin, darf ich nicht alles. Das Sakrament der Taufe und die Eheassistenz sind mir anvertraut, so wie allen meinen Kolleginnen und Kollegen in der Seelsorge, besonders Frauen und Männern in einer Leitungsfunktion. Auch mir ist das Spenden von Sakramenten wie dem der Versöhnung und der Krankensalbung verwehrt. Doch in meinem Alltag als Klinikseelsorger begegnet mir tagtäglich die Sehnsucht nach Vergebung und Heilung. Der kranke Mensch sucht nach Halt, Geborgenheit, Vergebung, Liebe und er sehnt sich nach einem hoffnungsvollen Neuanfang. 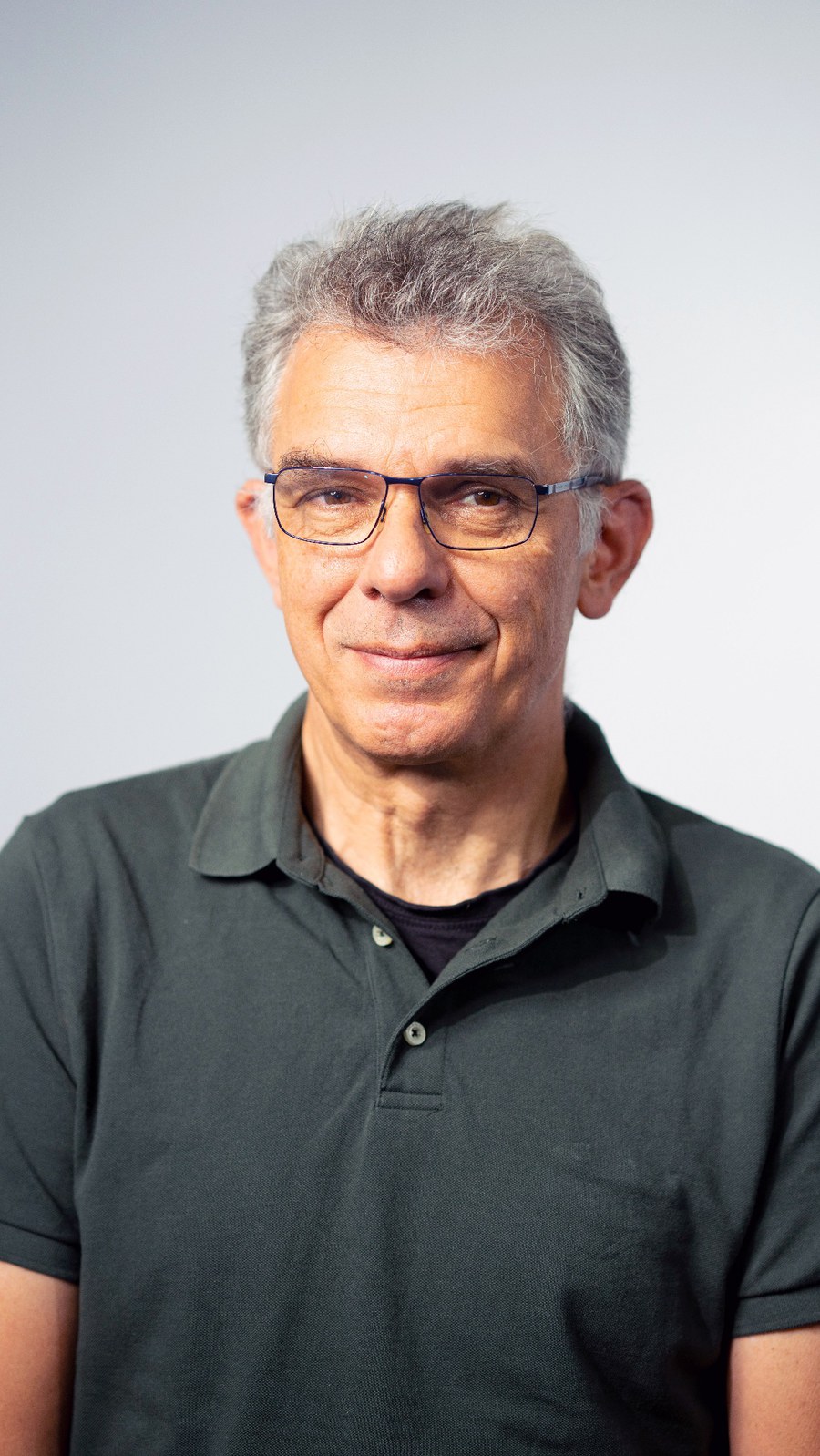
Als Seelsorger stellt sich auch mir früher oder später die Frage: Wie kann ich den kranken Menschen, der in besonderer Weise auf leibliche-sinnhafte Zeichen angewiesen ist, erfahren lassen, dass Gott ihn liebt?
Das Spenden von Sakramenten lässt sich nicht immer planen. So nehme ich im Speziellen das Vaterunser zu Hilfe, biblische Texte, Psalmen und Gleichnisse. Das abschliessende Kreuzzeichen mit Weihwasser bestärkt in diesem Moment die Nähe Gottes. Stimmt, das ist kein Sakrament. Doch der Patient oder die Patientin erfährt, dass Gott bedingungslos da ist.
Mich schmerzt es, dass möglicherweise dadurch Sakramente in Vergessenheit geraten oder im gesellschaftlichen Gedächtnis an Bedeutung verlieren. Im Zentrum steht für mich immer der Mensch: «Ich war krank, und ihr habt mich besucht» (Mt 25,36). Als Seelsorger bin ich für die Patientinnen und Patienten da und vertraue darauf, dass sie Gottes Nähe erfahren dürfen.
Ein Wort von Andrea Schwarz begleitet mich dabei: «Meistens wird Gott ganz leise Mensch, wenn Menschen zu Menschen werden! »
Die Sakramentenspendung betrifft zuerst die Menschen, die ein Sakrament (noch) empfangen möchten. Es betrifft aber auch alle Seelsorgenden und ist nicht nur eine Geschlechterfrage.
Gibt es einen geschwisterlichen Weg in unserer Kirche? Ich weiss, wie lange Menschen, besonders Frauen, schon darauf hoffen. Auch ich als Mann und Kleriker.»
Mit Maria Magdalena neue Ämter und Rollen finden
«Ich werde ins Spital gerufen. Ein Mensch liegt im Sterben. Manchmal sind Familienangehörige anwesend. Ich soll die Krankensalbung spenden. Die Texte und der Ritus fokussieren auf die Sündenvergebung. Die Vorgaben würden gut passen vor einer anstehenden Operation, im Rahmen eines seelischen Grossreinemachens. Wenn die Person aber bereits im Dämmerzustand ist, spricht der Ritus bei allen Anwesenden ins Leere. 
Es wird gelehrt, die Krankensalbung nicht mehr als «Letzte Ölung» zu bezeichnen. Abgesehen von der seltsamen Formulierung, die ein wenig nach Auto-Garage klingt, ist es aber genau das, was in der Sache verlangt wird: Eine letzte verbindende und verbindliche heilige Handlung und eine geistlich aufgeladene Atmosphäre, die die Würde der sterbenden Person unterstreicht und die im Raum schwebende Liebe zum Verstorbenen noch einmal sichtbar ins Zeichen hebt. Quasi eine heilige Fahrkarte, um dem Ungewissen und dem Schmerz eine tröstliche Richtung zu geben. Loslassen ermöglichen; gut sein lassen.
Dafür bräuchte/brauche ich als Priester andere passendere Texte. Oder besser: Es bräuchte - ohne mich - einen echten «Letzte Ölung»-Ritus - abgeleitet von der Salböl tragenden Maria Magdalena; und dieses Mal ganz absichtlich und heilbringend aus den Händen einer Frau, welche die geistliche Figur der Maria Magdalena repräsentiert. Die Situation soll biblisch klangvoll sein - und nicht irgendwie esoterisch-ägyptisch.
Die katholische Idee, Heil darzustellen (und nicht herzustellen) - durch Zeichen, Riten, Rollen und Spiel ist mir sympathisch. Es wird nach Regeln gespielt. Der Bauer auf dem Schachfeld bewegt sich anders als die Dame. Dann funktioniert das Spiel. Ein gequälter Königssohn braucht eine Bühne, hält sich an seinen Text und verzichtet auf Merchandising - dann funktioniert das Theaterstück und es kommt Shakespeares Hamlet zum Vorschein. Der Orchestermusiker hält sich an seine Partitur, dann funktioniert die Komposition, dann wird es Beethoven. Ein dekonstruiertes «ist doch egal, wer was wann wie mit welchen Klamotten macht» befreit vielleicht das Charisma einer einzelnen Person, doch am Horizont droht der Kampf um Einzelfälle, Einfälle, Präzedenzfälle, Kniefälle und Sonderfälle, die Publikum, Gemeinschaft, Volk Gottes früher oder später pulverisieren.
In unserer jetzigen, gar nicht mal so alten Liturgie hat man es verschenkt, viele wichtige Rollen, Ämter, Spielfiguren und Darstellungen von Maria Magdalena her abzuleiten und im Gemeindeleben zu etablieren.
Im Falle der «Letzten Ölung» haben wir eine klassische Bedürfnislage, die mit den eigenen Schriften gut beantwortet werden kann. Ich bin sicher, wir haben noch viele Schätze heilvoller Begegnung zu heben. Mein Eindruck ist, dass Papst Franziskus auch in diese Richtung denkt: Jetzt - unter der Gestalt von Maria Magdalena - neue Ämter und Rollen finden (und finanziell auszustatten), die auf pastorale Situationen geistlich (und nicht geschlechtlich) reagieren. Das halte ich für besser, als alle Energie im verminten Gelände Amt und Eucharistie zu verballern und mit politischer Krämerei und akademischer Empfindlichkeit aufzuladen. Und die Patronin dieses geschmeidigen Projektes ist Maria Magdalena, die Franziskus zur Apostelin der Apostel erhoben hat.»
Zwei Seelsorgerinnen, Tonja Jünger und Barbara Ulsamer, haben bereits in einem früheren Beitrag «Dürfen Sie das als Frau?» von ihren Erfahrungen erzählt.






Kommentare anzeigen